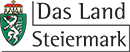Passiver Hochwasserschutz - Lafnitz
Die Lafnitz wird von den Wasserbauverwaltungen des Burgenlandes und der Steiermark betreut. In der burgenländischen Gemeinde Wolfau wurde 1982 das Grundzusammenlegungsverfahren eingeleitet. Im Herbst 1986 setzten die Arbeiten vor Ort ein. Dabei stieß man im Talboden der Lafnitz bald auf die ersten Probleme. Die immer wieder eintretenden Laufverlagerungen der Lafnitz konnten mit der Vorgabe, daß sich die Flächen der Abfindungsgrundstücke nicht verändern dürfen, auf keinen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Zusätzlich kam es in diesem rund 70 ha großen Gebiet regelmäßig zu Überschwemmungen. Etlichen Grundeigentümern konnte nicht zugemutet werden, sich von hochwasserfreien Grundstücken in hochwasserbetroffene verlegen zu lassen.
1987 trat die Bauernschaft aus Unterlungitz an die steirische Wasserbauverwaltung mit der Bereitschaft heran, gemeinsam ein Ablösemodell für die gefährdete Uferlandschaft an der Lafnitzau zu entwickeln. Je nach Notwendigkeit sollte zur Erhaltung des Naturraumes Lafnitzau Grund eingelöst werden. Ausschlaggebend hierfür war die Tatsache, daß die hochwasserführende Lafnitz immer wieder Ufer einriß und Boden abtrug. Dabei wurden auch Zufahrten zu Grundstücken, die sich innerhalb von Flußschleifen befanden, abgeschnitten.
Diese beiden Punkte zum Anlaß nehmend, begannen die Wasserbauverwaltungen vor rd. zehn Jahren, die Idee des Passiven Hochwasserschutzes globaler abzustecken (Wasserrückhalt in der Landschaft) und entsprechend umzusetzen.
Zwischen 1988 und 1995 erteilte das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft der burgenländischen und der steirischen Wasserbauverwaltung die technische und finanzielle Genehmigung für die Ablöse von rd. 148 ha lafnitznaher Flächen, die ins öffentliche Wassergut übertragen wurden. Darüber hinaus wurden mit etlichen Grundeigentümern hinsichtlich gewässerverträglicher Nutzungen Übereinkommen, deren Dauer meist 20 Jahre beträgt, getroffen. Diese Übereinkommen erfassen ein Flächenausmaß von rd. 350 ha.
Als Hauptziele des Passiven Hochwasserschutzes an der Lafnitz sind anzuführen:
1987 trat die Bauernschaft aus Unterlungitz an die steirische Wasserbauverwaltung mit der Bereitschaft heran, gemeinsam ein Ablösemodell für die gefährdete Uferlandschaft an der Lafnitzau zu entwickeln. Je nach Notwendigkeit sollte zur Erhaltung des Naturraumes Lafnitzau Grund eingelöst werden. Ausschlaggebend hierfür war die Tatsache, daß die hochwasserführende Lafnitz immer wieder Ufer einriß und Boden abtrug. Dabei wurden auch Zufahrten zu Grundstücken, die sich innerhalb von Flußschleifen befanden, abgeschnitten.
Diese beiden Punkte zum Anlaß nehmend, begannen die Wasserbauverwaltungen vor rd. zehn Jahren, die Idee des Passiven Hochwasserschutzes globaler abzustecken (Wasserrückhalt in der Landschaft) und entsprechend umzusetzen.
Zwischen 1988 und 1995 erteilte das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft der burgenländischen und der steirischen Wasserbauverwaltung die technische und finanzielle Genehmigung für die Ablöse von rd. 148 ha lafnitznaher Flächen, die ins öffentliche Wassergut übertragen wurden. Darüber hinaus wurden mit etlichen Grundeigentümern hinsichtlich gewässerverträglicher Nutzungen Übereinkommen, deren Dauer meist 20 Jahre beträgt, getroffen. Diese Übereinkommen erfassen ein Flächenausmaß von rd. 350 ha.
Als Hauptziele des Passiven Hochwasserschutzes an der Lafnitz sind anzuführen:
- Sicherung der Hochwasserabflußgebiete
- Erhaltung bzw. Schaffung von Retentionsräumen
- Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit
- Grundwasseranreicherung
- Gewässerschutz
- Verminderung der Pflege- und Instandhaltungsarbeiten
Die Bedeutung des Passiven Hochwasserschutzes an der Lafnitz ist durch hydrologische und hydraulische Untersuchungen insofern belegt, als der Retentionsraum flußabwärts von Rohrbach eine wesentliche Bedeutung für die Hochwassersituation in den Ortschaften Lafnitz, Neustift, Wörth, Neudau, Burgau und Rudersdorf besitzt. Als Beispiele seien die Pegel Rohrbach und Wörth herausgegriffen.
HQ100 Pegel Rohrbach 300 m3/s
HQ100 Pegel Wörth 190 m3/s
Durch die Sicherung und zusätzliche Aktivierung von Retentionsräumen soll ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Hochwasserabflußverhältnisse gesetzt werden. Durch die Umwandlung der Flächennutzung (Acker in Wiese u. Auwald) wird ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Gewässergüte geleistet.
Zukünftig werden die Pflege- und Instandhaltungsarbeiten im Unterliegerbereich auf ein Mindesterfordernis reduziert. So werden beispielsweise Ufereinrisse des Dammuferflusses nur mehr dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zwingend erfordern, saniert. Der Hochwasserübertritt ins Vorland wird damit begünstigt. Demzufolge tritt eine Aktivierung der fließenden und der stehenden Retention ein. Durch Sedimentationsvorgänge im Vorland werden aufwendige Räumungsarbeiten, vor allem in den flußabwärts gelegenen Regulierungen im Bereich der Ortschaften weniger oft erforderlich.
HQ100 Pegel Rohrbach 300 m3/s
HQ100 Pegel Wörth 190 m3/s
Durch die Sicherung und zusätzliche Aktivierung von Retentionsräumen soll ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Hochwasserabflußverhältnisse gesetzt werden. Durch die Umwandlung der Flächennutzung (Acker in Wiese u. Auwald) wird ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Gewässergüte geleistet.
Zukünftig werden die Pflege- und Instandhaltungsarbeiten im Unterliegerbereich auf ein Mindesterfordernis reduziert. So werden beispielsweise Ufereinrisse des Dammuferflusses nur mehr dort, wo es die örtlichen Verhältnisse zwingend erfordern, saniert. Der Hochwasserübertritt ins Vorland wird damit begünstigt. Demzufolge tritt eine Aktivierung der fließenden und der stehenden Retention ein. Durch Sedimentationsvorgänge im Vorland werden aufwendige Räumungsarbeiten, vor allem in den flußabwärts gelegenen Regulierungen im Bereich der Ortschaften weniger oft erforderlich.