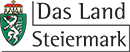Indoor VS Thörl 08.04.2010
In der  VS Thörl wurde am 8.04.10 von einem 3-köpfigen Wasserland-Team ein Wassererlebnistag durchgeführt. Nach der Begrüßung und Aufteilung der Klasse in zwei Gruppen wurden die beiden Einheiten - „Wasserkreislauf" und „Wasser mit allen Sinnen"- gleichzeitig bzw. im Wechsel mit den Gruppen durchgearbeitet. Mit Unterstützung der Klassenlehrerin entstand eine angenehme Arbeitsatmosphäre und für die Beteiligten ein interessanter Vormittag.
VS Thörl wurde am 8.04.10 von einem 3-köpfigen Wasserland-Team ein Wassererlebnistag durchgeführt. Nach der Begrüßung und Aufteilung der Klasse in zwei Gruppen wurden die beiden Einheiten - „Wasserkreislauf" und „Wasser mit allen Sinnen"- gleichzeitig bzw. im Wechsel mit den Gruppen durchgearbeitet. Mit Unterstützung der Klassenlehrerin entstand eine angenehme Arbeitsatmosphäre und für die Beteiligten ein interessanter Vormittag.
Die mehr experimentelle Einheit orientiert sich an dem Formwechsel des Wassers im Wasserkreislauf, während die andere, mehr erlebnisbetont, das Wasser im Bezug zu den 5 menschlichen Sinnesqualitäten erfahrbar macht. Beide beginnen mit einer Art ‚brainstorming', wo wir versuchen, das globale Ganze zu sehen, bevor wir die besonderen Erscheinungsformen des Wassers untersuchen. Den globalen Wasserkreislauf diskutieren wir mithilfe eines Schaubilds:
 VS Thörl wurde am 8.04.10 von einem 3-köpfigen Wasserland-Team ein Wassererlebnistag durchgeführt. Nach der Begrüßung und Aufteilung der Klasse in zwei Gruppen wurden die beiden Einheiten - „Wasserkreislauf" und „Wasser mit allen Sinnen"- gleichzeitig bzw. im Wechsel mit den Gruppen durchgearbeitet. Mit Unterstützung der Klassenlehrerin entstand eine angenehme Arbeitsatmosphäre und für die Beteiligten ein interessanter Vormittag.
VS Thörl wurde am 8.04.10 von einem 3-köpfigen Wasserland-Team ein Wassererlebnistag durchgeführt. Nach der Begrüßung und Aufteilung der Klasse in zwei Gruppen wurden die beiden Einheiten - „Wasserkreislauf" und „Wasser mit allen Sinnen"- gleichzeitig bzw. im Wechsel mit den Gruppen durchgearbeitet. Mit Unterstützung der Klassenlehrerin entstand eine angenehme Arbeitsatmosphäre und für die Beteiligten ein interessanter Vormittag.Die mehr experimentelle Einheit orientiert sich an dem Formwechsel des Wassers im Wasserkreislauf, während die andere, mehr erlebnisbetont, das Wasser im Bezug zu den 5 menschlichen Sinnesqualitäten erfahrbar macht. Beide beginnen mit einer Art ‚brainstorming', wo wir versuchen, das globale Ganze zu sehen, bevor wir die besonderen Erscheinungsformen des Wassers untersuchen. Den globalen Wasserkreislauf diskutieren wir mithilfe eines Schaubilds:
Wir lassen den Wasserkreislauf mit der Verdunstung beginnen, lernen ihre Bedingungen unterscheiden, einerseits den Bewegungs- und relativen Feuchtezustand der Luft, anderseits die Möglichkeiten des Stoffs, der Luft Oberfläche darzubieten.
Als nächstes machen wir sichtbar, wie in Luft sublimierter Wasserdampf infolge von Abkühlung wieder niederschlägt, als Regen.
(Über dem Meer wäre der Kreislauf damit schon geschlossen; auf dem Land gibt es durch die -erhebliche- Evapotranspiration z,B. der Wälder auch einen kurzgeschlossenen Kreislauf)
Das -entsalzte- Regenwasser geht zum großen Teil über dem Land nieder. Wir betrachten die verschiedenen Umstände der Versickerung. Humus ist offenporig, kann aber enorm viel Wasser binden, mehr oder weniger durchlässig sind Bodenarten wie Sand und Kies, Lehm bzw. Ton dagegen fast undurchlässig.
Das -entsalzte- Regenwasser geht zum großen Teil über dem Land nieder. Wir betrachten die verschiedenen Umstände der Versickerung. Humus ist offenporig, kann aber enorm viel Wasser binden, mehr oder weniger durchlässig sind Bodenarten wie Sand und Kies, Lehm bzw. Ton dagegen fast undurchlässig.
Die wasserdurchlässigen Schichten nutzen wir für unsere Minikläranlage: für stoffliche Verunreinigungen wirken sie wie Siebe-
- und wenn wir unter diese reinigenden Bodenschichten noch eine undurchlässige Lehmschicht anbringen, sammelt sich das Wasser zu einer Quelle (für jedes Kind im Minibau). Mit dem Fluss ins Meer ist der Kreislauf geschlossen.
Die zweite Einheit befasste sich mit der sinnlichen Wassererfahrung. Zunächst ging es darum, den äußerst geringen Anteil des Trinkwassers am globalen Wasserreichtum zu demonstrieren ( 1 Stamperl aus einem 10l-Eimer; über ¾ des Süßwassers ist unzugänglich, in Eis gebunden, ein kleinerer Teil als Grundwasser und im Boden, Wasser aus Flüssen und Seen ist meist nicht zum Trinken geeignet ), das dazu, wie von den Kindern bemerkt, sehr ungleich auf dem Festland verteilt ist . Daraus ergab sich, nachdem der Wasserreichtum Österreichs nicht mehr als selbstverständlich erschien, eine Diskussion über Möglichkeiten des bewussten Umgangs bzw. Wassersparens.
Nach dieser theoretischen Unterscheidung des Süßwassers konnten wir nun seine Wechselwirkung mit unseren 5 Sinnen untersuchen. Unmittelbar spüren wir Wasser, wenn es eintritt nach innen oder wenn wir außen davon umhüllt sind bzw. eintauchen - einmal mit unserem Geschmacksinn, zum andern mit dem Tastsinn unserer Außenhaut. Wir nutzten unsere ungebrauchten Geschmäcker, um drei Proben klaren nach nichts schmeckenden Wassers zu kosten, wobei wir merkten, dass das Nichts eben nicht gleich schmeckt : der feine Unterschied im Mineralgehalt ist im Geschmack wahrzunehmen.
Nase, und noch weniger Auge und Ohr, sind nicht so unmittelbar dem Wasser ausgesetzt. Gerüche sind Beimengungen im Wasser, die entweichen - in unserem Fall verschiedene ätherische Öle, die sogar hydrophob sind - und dem Bewusstsein qualitative Hinweise auf den besonderen Inhalt der Flüssigkeit geben.
Der optische Sinn mischt sich mitunter recht manipulativ in die Geschmackswahrnehmung ein: Leitungswasser schmeckt nach Blaubeer oder Waldmeister, sobald es blau bzw. grün gefärbt ist; gelbes Zuckerwasser nach Zitrone; oranges Essigwasser schmeckt irgendwie nach Benzin, und sogar rotes Salzwasser nach Himbeerlimo. Das Auge vermittelt dem Bewusstsein Information, welche die unmittelbare Empfindung überlagert.
Erst recht der akustische Sinn ruft mittelbar Vorstellungen im Bewusstsein hervor, wobei es natürlich das Wasser selbst ist, das beim Auftreffen auf sich selbst oder äußere Widerstände Geräusch macht (abgesehen von charaktristischen Fremdgeräuschen wie Enten-und Froschgequake u.a.).
Der Tastsinn nimmt den Bewegungszustand, besonders die Temperatur des Wassers wahr. Wir lassen ihn -sozusagen mit verbundenen Augen - Dinge erkennen, die vom Wasser in Schwimmende und am Grund liegende unterschieden sind, also mit dem Wasser selbst nichts zu tun haben. Vielleicht wird das Erlebnis dieses „reinen Vorstellens" bei den Kindern doch auch dadurch verstärkt, dass die zu erratenden Dinge im Wasser getaucht sind, so als ob die Vorstellung auch in einem flüssigen Medium stattfindet.